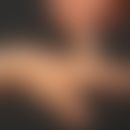Erstbeschreiber/Historie
Die erste internationale Klassifikation von Kopfschmerzen wurde 1966 u. a. zur Uniformierung der Einschlusskriterien für Studien erstellt (Agosti 2015).
In Deutschland hat die Kopfschmerzforschung ihren Beginn in den 1970er Jahren durch D. Soyka. Er ermöglichte die Gründung der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) am 28.06.1979 in Erlangen und hat außerdem die Gründung der International Headache Society (IHS) mit angestoßen (Straube 2015)).
Im Jahre 1981 wurde in England die IHS (International Headache Society) gegründet. Sie übernahm die Erarbeitung und Publikationen der ICHD (International Classification of Headache). Im weiteren Verlauf erfolgten mehrere Revisionen (Agosti 2015).
Das SUNCT-Syndrom wurde erstmals im Jahre 1989 von Sjaastad et al. Beschrieben (Agosti 2015).
Die Leitlinie der Europäischen Akademie für Neurologie zur Behandlung von Kopfschmerzen durch Medikamentenübergebrauch wurde erstmals 2020 veröffentlicht (Diener 2020).
Definition
Kopfschmerzen sind das Leitsymptom zahlreicher Krankheitsbilder (Michel 2016). Sie stellen ein neurologisches Symptom dar, das Patienten am häufigsten in eine Notaufnahme führt (Straube 2018).
Auch interessant
Einteilung
Die ICHD unterscheidet über 200 Typen von Kopfschmerzen (Agosti 2015).
Man differenziert bei Kopfschmerzen zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen.
- Primäre Kopfschmerzen:
Sie treten bei > 92 % der Betroffenen auf (Herold 2018). Für diese Arten von Kopfschmerzen gibt es keine klaren Ursachen (Agosti 2015). Dazu zählen:
- Spannungskopfschmerzen 69% (betrifft ca. 10,3% der Frauen und 6,5% der Männer [Neeb 2023])
- Migräne 16%
- Idiopathisches Stechen 2%
- Anstrengungskopfschmerzen 1%
- Clusterkopfschmerzen 0,1% (Kasper 2015)
- SUNCT-Syndrom, seltenste primäre Kopfschmerzerkrankung (Agosti 2015)
- Sekundäre Kopfschmerzen
Sie werden durch exogene Störungen verursacht. Dazu zählen:
- Systemische Infektionen 63%
- Kopfverletzungen 4%
- Vaskuläre Erkrankungen 1%
- Subarachnoidalblutungen < 1%
- Hirntumoren 0,1% (Kasper 2015)
- Kraniale Neuralgien, zentrale und primäre Gesichtsschmerzen:
Sie finden sich bei < 1% aller Kopfschmerzpatienten und können entstehen durch z. B.:
- Okuläre diabetische Neuropathie
- Zoster
- Primäre Trigeminusneuralgie (Herold 2018)
Vorkommen/Epidemiologie
Kopfschmerzen ohne exogene Ursache werden am häufigsten durch Migräne verursacht, gefolgt von Spannungskopfschmerzen und trigemino-autonomen Kopfschmerzen (Kasper 2015).
Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Ursachen, weshalb Patienten einen Arzt aufsuchen (Kasper 2015).
Pathophysiologie
Kopfschmerzen können auf zweierlei Arten entstehen. Zum einen als somatische Schmerzen durch Reizung der peripheren Nozizeptoren, zum anderen bei Schädigung bzw. unangemessener Aktivierung schmerzerzeugender Bahnen im ZNS (Kasper 2015).
Klinik
Bei ca. 60% der Betroffenen bestehen mittelstarke Kopfschmerzen. Die Dauer der Spannungskopfschmerzen liegt bei durchschnittlich 14,3 h (Göbel 2025), laut Leitlinie zwischen 30 min. bis zu maximal 7 Tagen (Neeb 2023).
Insbesondere primäre Kopfschmerzen führen oftmals zu erheblichen Behinderungen und Beeinträchtigungen der Lebensqualität (Kasper 2015).
Es kann sich bei sekundären Kopfschmerzen auch um eine Notfallsituation handeln. Hier gilt als Faustregel: Je intensiver und akuter ein Kopfschmerz einsetzt, desto wahrscheinlicher handelt es sich um eine Notfallsituation (Keidel 2006).
Diagnostik
- Anamnese
Der Anamnese kommt bei Kopfschmerzen eine große Bedeutung zu. Hierbei ist insbesondere zu erfragen:
- Erstmals oder chronisch aufgetreten
- Lokalisation des Schmerzes
- Dauer der Schmerzen
- Begleitsymptome wie z. B. Übelkeit, Schwitzen, Krampfanfall, Sehstörungen, Schwindel, Anzeichen einer akuten Infektion,
- Frage nach bestehender Schwangerschaft
- Medikamente erstmals eingenommen bzw. Medikamente akut abgesetzt
- Familienanamnese hinsichtlich Kopfschmerzen
- Blutdruckmessung (Keidel 2006)
- Neurologische Untersuchung
- Internistische Untersuchung (Neeb 2023)
- Augeninnendruckmessung (Agosti 2015)
- Für Spannungskopfschmerzen und Migräne gibt es zusätzlich zahlreiche Fragebögen (Agosti 2015).
Apparative Untersuchungen sollten erfolgen bei:
- Bei Schmerzen einer vorher nie gekannten Intensität
- Konsumierender Grunderkrankung wie z. B. HIV, Tumor
- Begleitsymptomen wie z. B.
- Fieber
- Meningitis
- Epileptischer Anfall
- Persönlichkeitsveränderungen
- Papillenödem
- Kognitiven Störungen
- Auftreten der Schmerzen bei Anstrengung oder Valsalva-Manöver (Zettl 2021)
- Auffälligem neurologischen Befund
- Neu aufgetretenem Kopfschmerz nach dem 50. Lebensjahr
- Trigeminusneuralgie
- Bei Auftreten eines trigeminoautonomem Kopfschmerz
- Untypischer Kopfschmerzanamnese
- Veränderung bekannter Kopfschmerzen (Holle-Lee 2021)
Therapie allgemein
Die therapeutischen Möglichkeiten sind zahlreich und richten sich nach der Ursache der Kopfschmerzen.
Naturheilkunde
s.a. unter Migräne (Ordnungstherapie, s.a. Baunscheid-Verfahren, Moxibustion, Schröpfkopfmassage). Wassertreten nach Kneipp, auch Fußreflexzonenmassage.
Phytotherapie intern
Mit positiver Monographie: Salicis cortex, Weide
ohne Monographie: Harpagophyti radix, Tanaceti parthenii herba (positive Monographie für Migräne), Betelnuss, Herba Asperulae, Herba Cannabinae aquaticae, Hundskamille, stinkende; Maulbeerstrauch indischer; Noni-Saft, Tanaceti parthenii herba, Uzarae radix, Wermut
LiteraturFür Zugriff auf PubMed Studien mit nur einem Klick empfehlen wir  Kopernio
Kopernio
 Kopernio
Kopernio- Agosti R, Diener H C, Limmroth V (2015) Migräne und Kopfschmerzen: Ein Fachbuch für Hausärzte, Fachärzte, Therapeuten und Betroffene. Karger AG Basel 3-4, 85, 382
- Diener H C, Antonaci F, Braschinsky M, Evers S, Jensen R, Lainez M, Kristoffersen E S, Tasssorelli C, Ryliskiene K, Petersen J A (2020) Leitlinie der Europäischen Akademie für Neurologie zur Behandlung von Kopfschmerzen durch Medikamentenübergebrauch. European Journal of neurology. 10.1186/s42466-022-00200-0 , 4 , 1
- Göbel H (2025) Die Kopfschmerzen: Ursachen, Mechanismen, Diagnostik , Therapie. Springer Verlag Berlin 526-527
- Herold G et al. (2018) Innere Medizin. Herold Verlag 126
- Holle-Lee D (2021) Die Kopfschmerz Ambulanz: Formen und Ursachen von Kopfschmerzen. Die richtige Diagnose und wirksame Therapien. Herbig in der Franckh-Kosmos-Verlag Stuttgart 23
- Kasper D L, Fauci A S, Hauser S L, Longo D L, Jameson J L, Loscalzo J et al. (2015) Harrison‘s Principles of Internal Medicine. Mc Graw Hill Education 107-111, 2586-2590
- Keidel M (2006) Kopfschmerzmanagement in der Praxis. Georg Thieme Verlag Stuttgart / New York 54, 69, 100, 102, 110
- Michel O (2016) Kopfschmerzen. HNO 64, 61-73
- Neeb L et al. (2023) Diagnostik und Therapie des Kopfschmerzes vom Spannungstyp. S1-Leitlinie. In: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. www.dgn.org/leitlinien abgerufen am 07.08.2025
- Straube A (2018) Kopfschmerzen. In: Reimers C, Straube A, Völker K. Patienteninformationen Sport in der Neurologie- Empfehlungen für Ärzte. Springer Verlag Berlin, Heidelberg https://doi.org/10.1007/978-3-662-56539-1_9
- Straube A, Gaul C (2015) Kopfschmerz. Schmerz 29, 510-515 https://doi.org/10.1007/s00482-015-0040-2
- Zettl U K, Sieb J P (2022) Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen. Elsevier Urban und Fischer Verlag Deutschland Kapitel 17.7.1
Verweisende Artikel (18)
Betelnuss; Cytisi scoparii herba; Fußreflexzonenmassage; Harpagophyti radix ; Herba Asperulae; Herba Cannabinae aquaticae; Hundskamille, stinkende; Kohlumschlag; Maulbeerstrauch indischer ; Noni-Saft; ... Alle anzeigenWeiterführende Artikel (17)
Betelnuss; Fußreflexzonenmassage; Harpagophyti radix ; Herba Asperulae; Herba Cannabinae aquaticae; Hundskamille, stinkende; Kohlumschlag; Maulbeerstrauch indischer ; Migräne; Monographie; ... Alle anzeigenDisclaimer
Bitte fragen Sie Ihren betreuenden Arzt, um eine endgültige und belastbare Diagnose zu erhalten. Diese Webseite kann Ihnen nur einen Anhaltspunkt liefern.